Wenn die Rolling Stones einmal wirklich den Jahresringen Tribut zollen müssen und die Bühne ihren Avataren in speziell designten Hallen überlassen, stehen auf jeden Fall Green Day bereit, um den Platz als Stadionband für drei Generationen zu übernehmen. Rüstige Opas werden die Kreditkarte zücken, um mit dem Nachwuchs die tief in die männliche Seele eingebrannten Evergreens „Basket Case“, „21 Guns“ oder „Good Riddance“ zu singen und stolz mit dem Tour-T-Shirt für das jüngste Familienmitglied nach Hause gehen. Auf „Saviors“ gehen Billie Joe Armstrong und seine Kollegen ihren Weg konsequent weiter. Experimente sollen andere Bands machen – und das ist gut so. Was ist auch schlecht an eher ruhigen Intros, bevor dann die Breitwandgitarre einsetzt und zum Refrain geleitet? Keiner schreibt breitenverträgliche Hymnen wie den Titelsong oder „Fancy Sauce“ so wie Green Day – die es wie nebenenbei schaffen, ihren Wurzeln im kalifornischen Punk der späten achtziger und frühen neunziger Jahre treu zu bleiben. „Saviors“ ist der Beweis, dass Green Day wissen, wofür sie stehen. Darauf sind sie zu Recht stolz. Wir sehen uns im Sommer 2034 im Stadion unseres Vertrauens.
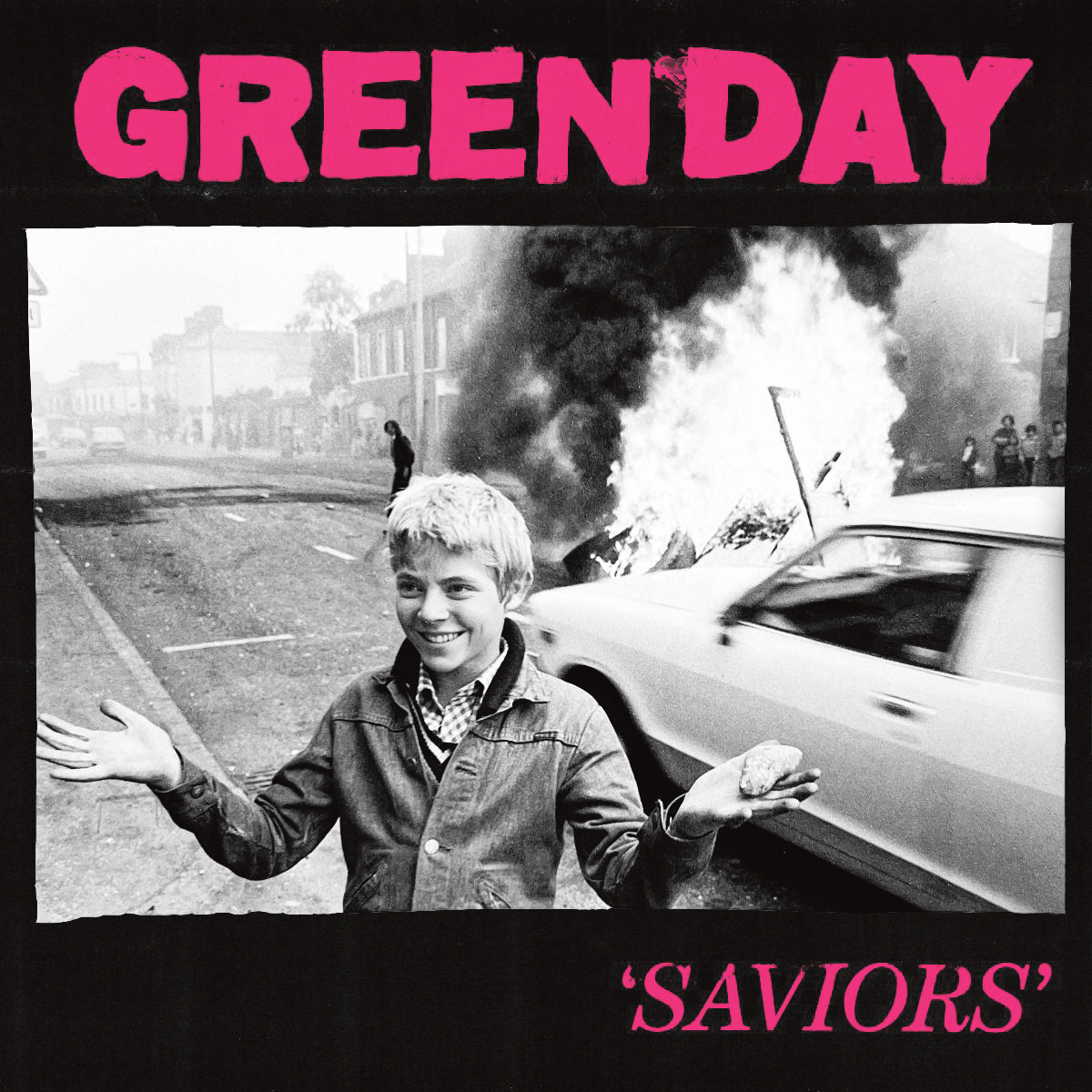
Green Day „Saviors“ (Reprise Records /Warner)
Wechseln wir von der West- an die Ostküste: Schon seit 2008 sind Real Estate in Brooklyn beheimatet. Seither feilt das Quintett rund um Sänger und Songschreiber Martin Courtney an zeitlosen Mid-Tempo-Songs, denen die Einflüsse von Bands wie Crowded House oder R.E.M. nicht abzusprechen sind. Die sechste Platte, „Daniel“, wurde im geschichtsträchtigen RCA Studio A in Nashville aufgenommen. Wie Green Day bleiben Real Estate ihrer Kernkompetenz treu. Da schwirren etwa Gitarrenlinien durch Songs, die Roger McGuinn für die Byrds eingespielt haben könnte, und auch wenn sich ab und zu eine Pedal Steel in den Sound verirrt, sind Real Estate nicht nach Nashville gefahren, um den Country-Rock neu zu erfinden. „Daniel“ ist ein fast schon perfektes Stück Gitarrenpop, das vor allem durch wunderbares Songwriting und die wohltuende Unaufdringlichkeit glänzt.

Real Estate „Daniel“ (Domino)
Wenn es in England noch so etwas wie Musikmagazine gäbe, dann würden The Last Dinner Party so ziemlich jedes Cover belegen, das sich finden würde. Wahrscheinlich wäre in guter alter Tradition schon spätestens bei der ersten Single der „New Musical Express“ aufgesprungen und hätte Seite um Seite mit Interviews und Backstagestories aus den noch verbliebenen Clubs gefüllt. Aber es kam anders: Die fünf Frauen arbeiteten in den Covid-Jahren an ihren Fähigkeiten, schärften das Konzept und traten als erwachsene Band, die keine Schwächen mehr hatte, an die Öffentlichkeit. Der dritte Auftritt war ausverkauft, die Band gab dann sogar Dresscodes (z. B „Velvet Goldmine“ oder „Victoriana“) für die Auftritte aus und tourte ein Jahr lang. Die erste Single war gleich das stark an ABBA angelehnte „Nothing Matters“ mit dem Refrain „I Will Fuck You Like Nothing Else Matters“ und der Weg zum Headliner war frei. Bemerkenswert ist, mit welcher Selbstsicherheit The Last Dinner Party mit „Prelude to Ecstasy“ von Genre zu Genre springen, ohne sich zu verlieren. Von der Pianoballade „Beautiful Boy“ über den Synthiepop der Sparks bis hin zu Anleihen bei Kate Bush oder Billie Eilish wird hier wirklich alles abgedeckt und in einer souveränen Art durchdekliniert, vor der man den Hut ziehen muss.

The Last Dinner Party „Prelude to Ecstasy“ (Universal)
Momentan wird im Wunderland Österreich eine großartige Platte nach der anderen veröffentlicht. Man denke nur an Endless Wellness, oder Ja Panik!. Natürlich gehört auch das dritte Soloalbum „Herbarium“ von Paul Plut in diese Reihe. Nach zwei Alben, die sich sehr lose mit dem Aufwachsen in der Ramsau und dem Verhältnis zur großen, vielleicht grausamen, übergeordneten Instanz beschäftigten, ist „Herbarium“ ein Dokument des Jagens von Ideen, vor allem aber des Flanierens, des Sammelns von Gedanken und des Aufhebens von Mitbringseln am Wegrand. Nur Paul Plut entscheidet, was er davon behält und was nach dem Heimweg wieder verschwindet. Geblieben sind 10 Lieder, wie sie verschiedener nicht sein könnten. Von „Devil Town“, einer einminütigen Daniel-Johnston-Coverversion über eine Vertonung von Christine Nöstlingers „In Wien“ bis hin zur ausladenden Soundmeditation „Luft“ ist alles vertreten. Das Universum von Paul Plut ist genauso groß wie seine Neugier und seine stille Widerständigkeit. Deshalb erscheint die Schatzkiste „Herbarium“ digital, als Kassette und als Buch.
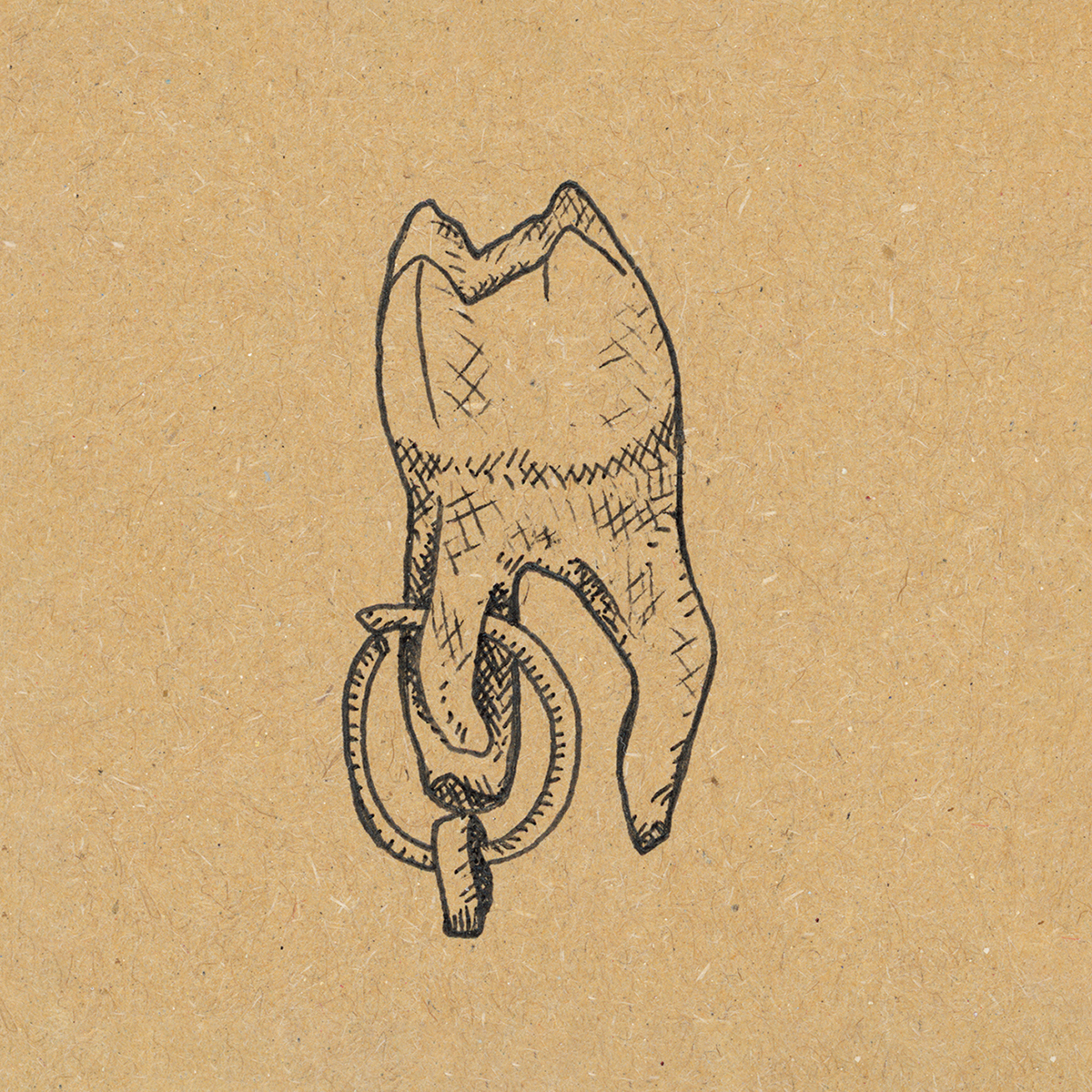
Paul Plut „Herbarium“ (Abgesang)
Da können die Altvorderen vom Ersten Wiener Heimorgelorchester natürlich nicht nachstehen. Gearbeitet wird nach wie vor auf günstigen Heimorgeln und vor allem mit einem Sprachwitz, dem Ernst Jandl und H. C. Artmann in jedem Fall applaudieren würden. „wo sind die blumen gebleibt“ ist der neueste Streich des Quartetts, das wie selbstverständlich an frühere Großtaten anschließt. Auch 30 Jahre nach der Bandgründung sprühen die Ideen, der Kampf gegen den Bierernst der Gegenwart wird weiter auf höchstem Niveau und mit offenem Visier aufgenommen. Oder, wie es das EWHO ausdrückt: „Alles passt zusammen / Äpfel, Birnen und Bananen“. Dieses Album sollte als akustische Pflichtlektion jedem Germanistikstudenten nahegebracht werden.

Heimorgelorchester „wo sind die blumen gebleibt“ (Ohm Records)
Noch ein kurzer Abstecher in die Vergangenheit: Das Solowerk von Nico wurde nach ihrem Tod 1998 nur durch die Verfilmung ihrer letzten Jahre kurz wiederbelebt, seither ist es aber dem Vergessen preisgegeben. Plötzlich taucht dieser Tage ein Song auf dem Soundtrack der Netflix-Serie „One Day“ auf, gleichzeitig werden ihr zweites und drittes Album nach dem Abschied von The Velvet Undergroud – „The Marble Index“ und „Desertshore“ – wiederveröffentlicht. John Cale war bei beiden Alben eine treibende Kraft, wobei er auf „The Marble Index“ all sein Wissen über die zeitgenössische Musik des 20. Jahrhunderts einfließen ließ und die Songstrukturen abseits von Pop ansiedelte. Auch mehr als 50 Jahre nach dem Entstehungsjahr 1968 ist „The Marble Index“ ein Brocken, den es zu entdecken lohnt, der aber alles andere als leicht verdaulich bleibt.
„Desertshore“, das zwei Jahre später erschien, ist eine Rückkehr der deutschen Tragödin zur Ballade und prägte den Sound ihrer nachfolgenden Karriere. Mitproduzent Joe Boyd zähmte Cale und stellte die Stimme Nicos und akustische Instrumente in den Mittelpunkt; so sind Lieder wie „Afraid“ oder „My Only Child“ bewegend wie eh und je.

Nico „Desertshore“ (Domino)


