Nachdem die Veröffentlichung von neuem Songs oder Tracks des Öfteren nur eine Entschuldigung ist, um auf Tour zu gehen und dort entweder den Lebensunterhalt zu verdienen oder noch ein paar Millionen abzustauben, ist die Dichte von neuen Releases eher dünn gesät. Eine Ausnahme sind die immer fleißigen weißen Männer, deren Geltungswut und Schaffenskraft auch in Zeiten wie diesen nicht nachgelassen hat. Nick Cave versucht nicht nur mit Gewinnspielen die Einkommen seiner Roadcrew zu sichern, er hat mit „Carnage“ (Goliath) auch ein Album mit seiner musikalischen rechten Hand Warren Ellis aufgenommen, das digital bereits erhältlich ist und in haptischer Form Ende Mai das Licht der Welt erblicken wird. Die restlichen Bad Seeds bleiben im Lockdown und dürfen auch nicht aus dem Homeoffice mitspielen. Und so stellt sich beim Hören die Frage, ob uns Cave mit seiner Band so konditioniert hat, dass wir die Bad Seeds einfach in ihrer ganzen Pracht hören wollen, oder ob die Band schlicht und einfach perfekt zu seinen Songs passt. Schon der Opener „Hand Of God“ reiht sich nahtlos in die Reihe der Songs ein, die die Fans lieben, aber irgendwann sehnt man sich nach dem emotionalen Breitwandsound der Band, den der Soundbastler Ellis einfach nicht ersetzen kann. Trotzdem heben sich die Songs von den emotionalen Gefühlserkundungen der beiden letzten Platten ab und werden die sicher lange Tour im nächsten Jahr um weitere Perlen ergänzen. Gebrochene Gewohnheiten können einen ja auch zu neuen Ufern führen.
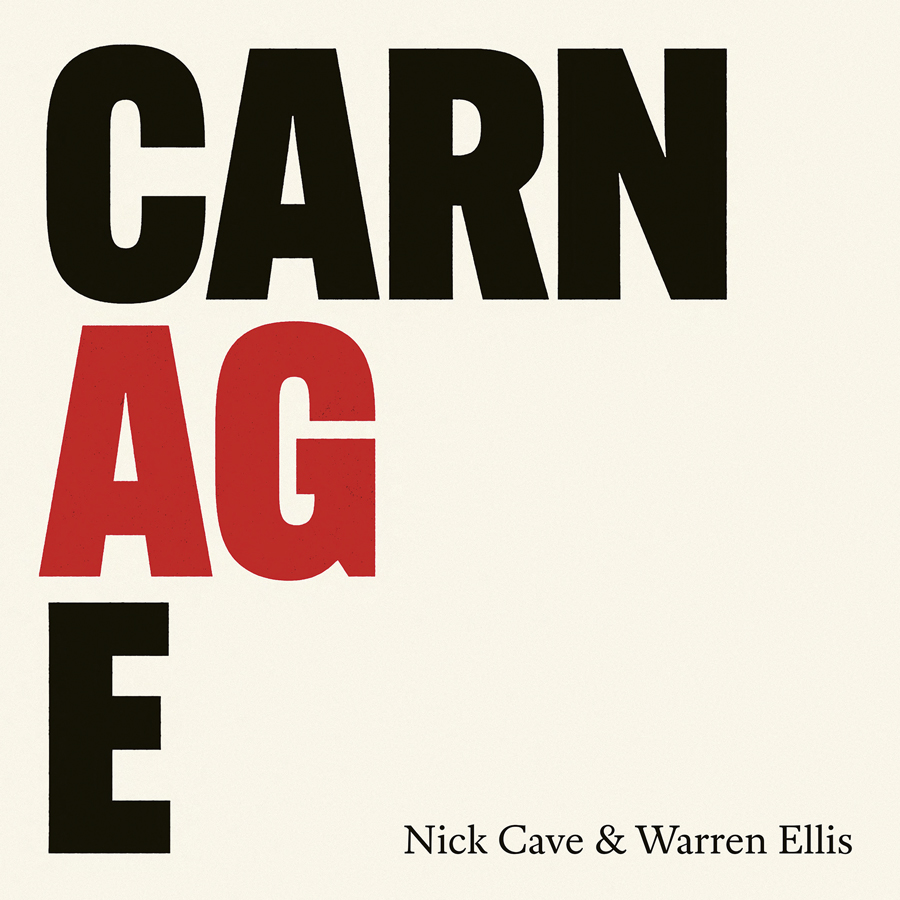
Nick Cave & Warren Ellis, „Carnage“ (Goliath Records/Rough Trade)
Matt Sweeney ist der Gitarrist der Wahl für jeden, der etwas auf seine Songs hält. Er prügelt in Iggy Pops Tourband das Riff von „I Wann Be Your Dog“ durch die Anlagen der Open Airs dieser Welt und half auch sensibel, dem letzten Album mit neuen Songs von Neil Diamond die Tiefe zu verleihen, die es verdiente. Wenn Will Oldham als Bonnie „Prince“ Billy tourt, ist er auch seit Jahren in der Band zu finden, und die beiden haben schon vor langer Zeit beschlossen auch zusammen zu schreiben. Das erste Ergebnis war vor 15 Jahren das famose „Superwolf“ und da Freundschaft nicht rostet und auch keine Eile kennt, legen die beiden demnächst „Superwolves“ (Drag City) vor. Dass sie Humor haben, verrät schon der Titel, aber es erstaunt doch, dass der Stil von Will Oldham über fast allen Liedern liegt, obwohl beide eigentlich getrennt schreiben und erst ganz am Ende die Entwürfe zusammenfügen. Die Ausnahme macht das getriebene „Hall Of Death“ in dem Sweeneys Gitarre den Song mit einem aggressiven Riff vor sich her treibt und so für einen absoluten Höhepunkt sorgt. Sonst macht es sich das Duo im weisen Balladenfach bequem und liefert hier wunderbare Einsichten wie „You Can Regret What You Have Done“ – oder gibt Lebensziele wie „Be Good To My Girls“ vor, gegen die wirklich niemand etwas haben kann. Wer ein neues „I See A Darkness“ sucht, wird hier nicht fündig, wer mit einer gelungenen Kollaboration zweier Meister ihres Faches vorlieb nehmen kann, der wird hier mit 14 Liedern bestens bedient.

Matt Sweeney & Bonnie ‘Prince’ Billy, „Superwolves“ (Drag City)
Kommen wir zu Charlotte Lawrence, die als Model angefangen hat und dann mit „The Joke’s On You“ auf dem Soundtrack des Superheldenvehikels „Birds Of Prey“ einen Hit hatte, der viele Playlisten anführte und bis heute 20 Millionen Streams generieren konnte. „Charlotte“ (Atlantic) nennt die jetzt 20-Jährige aus Los Angeles ihr erstes Minialbum und sie zeigt sich nicht als Marionette, sondern zumindest als Mitarchitektin ihrer zukünftigen Karriere. An der Schnittstelle zwischen Billie Eilish, dem Trotz der Jugend, breitem Indiepop amerikanischer Provenienz und mäßigen Autotuneeffekten hechelt sie nicht ihrem Hit nach, sondern versucht ihren eigenen Abdruck im Mainstream zu hinterlassen. Das gelingt bei einigen Songs wie „Slow Motion“ oder „Cowboys“ erstaunlich gut.

Charlotte Lawrence, „Charlotte“ (Atlantic)
In der Zeit vor dieser Zeit machten sich die Jungspunde von Black Country, New Road um 2019 in der Londoner Liveszene einen Namen, denn sie taten etwas, was gerade vollkommen aus der Zeit fiel. Als relativ große Band spielten sie, was ihnen in den Sinn kam, sie machten mit ihren Rockinstrumentarium Abstecher in Richtung Jazz, Krautrock und Klezmer, rockten dann wieder zäh dahin, nur um sich dann doch wieder beim klassischen Song zu finden. „For the first time“ (Ninja Tune) ist ihr Debütalbum, dessen Ziel es war, den Livesound auf Tonträger zu bringen. Ob sie dieses Ziel erreicht haben ist aus der Ferne schwer zu beurteilen, aber es ist klar, dass hier eine Band weiß, was sie will: Beweisen, dass sie ein Publikum mit ihrer Wucht wegblasen kann. Die Bläser liefern sich kraftvolle Duelle und wie es sich für eine junge Band gehört, wollen sie Grenzen sprengen. Das gelingt ihnen im Gegensatz zu vielen dünnen englischen Bleichgesichtern vor ihnen vortrefflich. John Zorn hätte mit dieser Band sicher seine Freude.

Black Country New Road, „For the first time“ (Ninja Tune/GoodToGo)
Um Freude zu verbreiten, wurde auch der Zirkus erfunden. Bernhard Paul hat den Zirkus mit seinem „Circus Roncalli“ wiedererfunden, ihm die Magie zurückgegeben und ihn zumindest ins 21. Jahrhundert gerettet. Harald Aue hat ihm in der Dokumentation „Ein Clown, ein Leben“ ein Denkmal errichtet und Ernst Molden und den Nino aus Wien gebeten, die Songs dazu zu schreiben. Nach anfänglicher Skepsis sagten sie zu und schrieben zum ersten Mal ein paar Lieder zusammen, das Ergebnis ist „Zirkus“ (Bader Molden Recordings). Wie es sich für gute Songwriter gehört, transzendieren Lieder wie Ninos „Café der Artisten“ oder Moldens „Warad I A Clown“ den ursprünglichen Anstoß, sie zu schreiben und stehen auch im Werk der Autoren stolz in der ersten Reihe. Die neuen Songs werden ergänzt um zwei alte Favoriten: Moldens Version von „I See A Darkness“, des oben besprochenen Will Oldham und Ninos „Es Geht Immer Ums Vollenden“. Wann die Bilder zur Musik auf der Leinwand zu sehen sind, bleibt noch offen, die Neugier darauf ist geweckt.

Ernst Molden und Der Nino aus Wien, „Zirkus“ (Bader Molden Recordings)
Vollendet ist bei Son of the Velvet Rat nie etwas, denn die Vollendung wäre der Schlusspunkt. Wer auf der letzten Platte „Dorado“ im ewig gültigen Song „Carry On“ behauptete, dass er erst angefangen hat weiterzumachen, der wird keinen Schlussstrich ziehen. „Dorado“ war in einer mit künstlerischen Höhepunkten nicht gerade sparsamen Laufbahn bis jetzt sicher ein Gipfel in der Karriere von Projektvorsteher Georg Altziebler, aber der gerade zitierte Satz war nicht nur ein Versprechen, sondern das Aussprechen einer Notwendigkeit. Er ist geboren, um Songs zu schreiben und jede Platte, jeder Song ist ein Weitermachen mit neuer Perspektive, neuen Horizonten und neuen Eindrücken. Und so ist „Solitary Company“ (Fluff and Gravy) wieder ein Abschnitt auf der Reise zu sich selbst. Mehrheitlich aufgenommen im derzeit wohl früheren Zweitwohnsitz in der kalifornischen Wüste mit dem befreundeten Gitarristen Gar Robertson als Koproduzent und mit dem Selbstvertrauen des Meisterwerks „Dorado“ im Rücken, traut sich Altziebler wieder ein Stück mehr zu. Trotz strenger Form werden die Texte freier und assoziativer, natürlich ohne auf die Kraft der Poesie zu vergessen. Wie bei dem Beinahe-Zeitgenossen Nick Cave schaut der Humor durchaus auch einmal um die Ecke. Mit „Solitary Company“ schafft sich Altziebler mit seiner Frau Heike Binder und seinem transatlantischen Musikerverbund endgültig ein neues Genre, in dem die klassische Songform mit Gitarre, Mundharmonika und seinen ureigenen Soundlandschaften eine einmalige Ehe eingehen, vor der man den Hut ziehen muss.

Son of the Velvet Rat, „Solitary Company“ (Fluff and Gravy)


