Peter Perrett sieht nicht unbedingt aus wie das strahlende Leben. Dem einstigen Frontmann der stilprägenden Band The Only Ones ist bewusst, dass es schon ein Wunder ist, dass er mit 72 noch die Gelegenheit hat, ins Studio zu gehen. Angesichts der immer knapper werdenden Zeit nahm er sich kurzerhand vor, das beste Album seines Lebens zu machen. Perrett wurde zwar nur kurz wirklich berühmt, aber die Only Ones beeinflussten Generationen von britischen Jugendlichen mit Gitarren im Kinderzimmer. So ist es kein Wunder, dass sich Fans wie Bobby Gillespie, Johnny Marr oder Carlos O’Connel von Fontaines D.C. an den Aufnahmen beteiligten und Perrett halfen, „The Cleansing“ zum großen Lebensrückblick zu machen, der teilweise wilde Abzweigungen nimmt. So ist dank Gillespie und Programmierer Douglas Hart „There For You“ der wohl beste The-Jesus-and-Mary-Chain-Song, der nie den Weg auf „Psycho Candy“ fand. Trotz der vielen Jahrzehnte, die Perrett an Drogen verschwendet hat, ist der Rückblick nie wehleidig, er hält die Fakten auch auf der Ballade „All That Time“ einfach fest. Und das demonstriert nicht nur Talent, sondern auch die Größe eines Songwriters, der ebendieses Talent über weite Teile seines Lebens in den Straßengraben geworfen hat.

Peter Perrett „The Cleansing“ (Domino Records)
Ein Gegenentwurf dazu sind Blur. Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James und Dave Rowntree haben die Band immer dann stillgelegt, wenn es künstlerisch und persönlich nicht mehr ging. Jeder baute sich abseits gemeinsamer Verdienste ein eigenes Leben auf, das sich sehen lassen kann. 2023 spielten sie (ohne den Druck, eine Scheidung finanzieren zu müssen) ihre ersten Konzerte im Wembley Stadion, und da bekanntlich in der Ruhe die Kraft liegt, triumphierten sie auf der ganzen Linie. Das Album „Live at Wembley Stadium“ dokumentiert diese Auftritte. Es zeigt eine Band, die mit ihrer Vergangenheit im Reinen ist, mit Verve und Begeisterung die Liebe des Publikums erwidert und diesem jene Hits schenkt, die es hören will. „Beetlebum“ und „Song 2“ sind Höhepunkte, aber es ist auch immer wieder erstaunlich zu hören, wieviel Britishness Albarn und Coxon in Songs wie „Park Life“, „Girls & Boys“ oder „Country House“ verpackt haben – und so das Werk eines Ray Davies von den Kinks auf gleichem Niveau fortführen. „Live at Wembley Stadium“ ist das Dokument der großartigen Konzertserie einer Band, die mit erhobenen Köpfen ihre Vergangenheit genießt und das Genre „Livealbum“ endlich wieder hochleben lässt.

Blur „Live at Wembley Stadium“ (Parlophone)
Kommen wir in die Gegenwart: Pom Pom Squad ist das Soloprojekt von Mia Berrin aus Brooklyn. Sie legt mit „Mirror Starts Moving Without Me“ ihr zweites Album vor. Mit einer leichten Anlehnung an Lewis Carolls „Alice in Wonderland“, die früh im Buch ihre Sinne verliert, erforscht Berrin nach den Turbulenzen der Veröffentlichung des Debüts und den damit verbundenen Anforderungen ihre Reise durch die Popwelt. Und den Preis, der dafür zu zahlen ist. Formal souverän zwischen lauten Gitarren, Beats und Balladen wie „Everybody’s Moving On“ dokumentiert sie ihre emotionale Achterbahnfahrt in Songs, die alles andere als unsicher wirken. Hier arbeitet eine Künstlerin, die sich ihrer Werkzeuge und ihres Könnens sehr bewusst ist und die durchaus auch feiern kann.

Pom Pom Squad „Mirror Starts Moving Without Me“ (City Slang)
Und genau dafür sind Caribou ein mehr als geeigneter Soundtrack. Projektbetreiber Dan Snaith hat an sich den Anspruch formuliert, dass kein Album so klingen darf wie die davor – und dieses Versprechen hält er auch bei „Honey“ ein. Die breiten generierten Soundflächen wurden diesmal durch Beats ersetzt, und er verweist damit auf die gerade sehr im Trend liegenden Achtziger. Dem lebenslustigen Hedonisten Snaith geht es hier darum, den Dancefloor zu erobern und die Körper im Stroboskoplicht tanzen und schwitzen zu sehen. Dieses Ziel erreicht er auf ganzer Linie und am Schluss verkündet er selbstbewusst sein Credo: „Got To Change“.
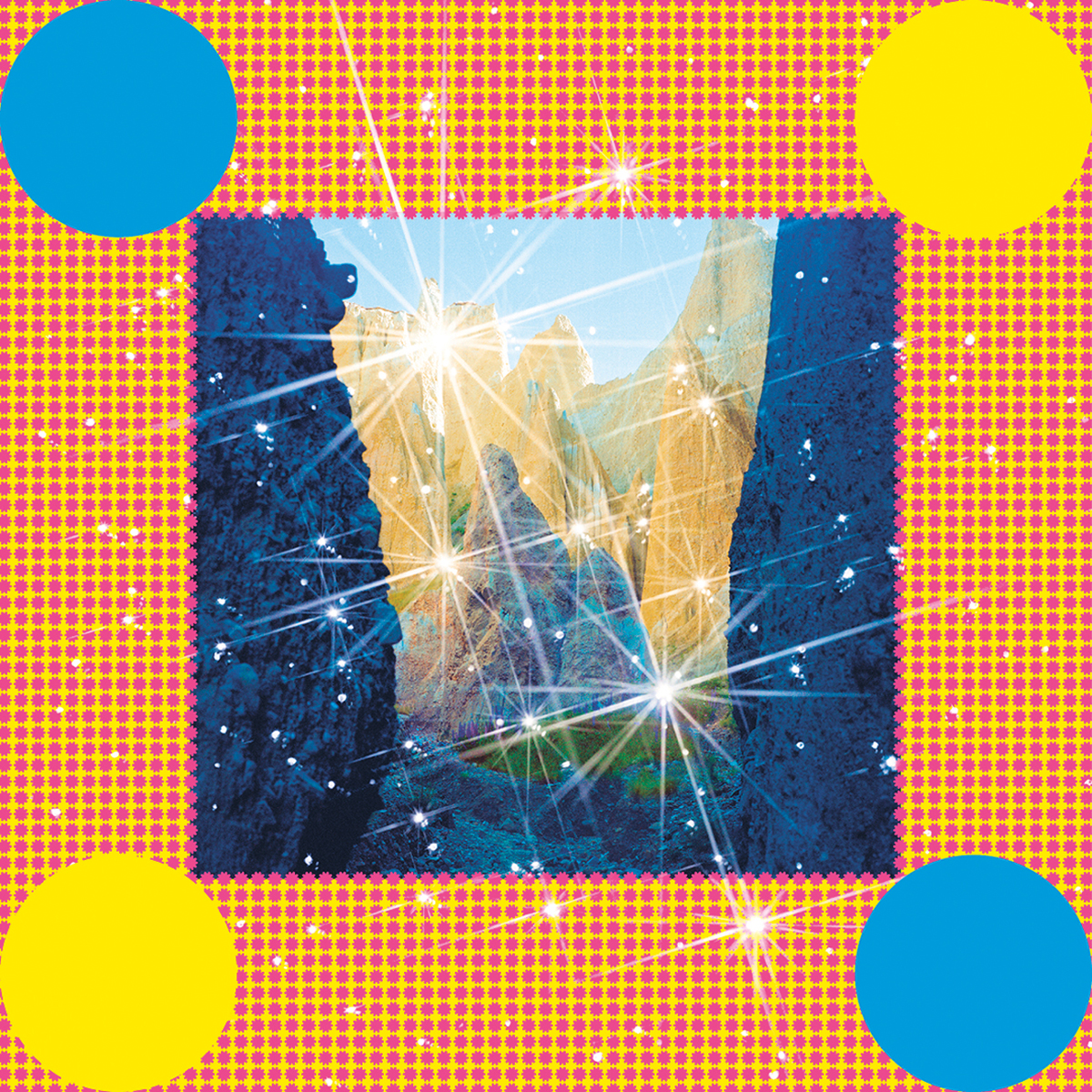
Caribou „Honey“ (City Slang)
Kommen wir zu jemandem, der Veränderung weniger schätzt. Bei Nick Cave kann man sich auf den Anzug, die Frisur, die unveränderte Haarfarbe, die Bühnenpräsenz und wohlüberlegte, gescheite Interviewantworten verlassen. Nach den letzten Veröffentlichungen im Duo mit seinem musikalischen Partner Warren Ellis und der Phase der Trauersongs holte er seine langjährige Band The Bad Seeds für „Wild God“ wieder ins Studio. Und macht das, wofür er seit Jahrzehnten geliebt wird: Er schreibt im Breitwandsound universelle Hymnen wie „Long Dark Night“, in die sich jeder fallen lassen kann, er beschwört den „Lord“ und predigt trotz aller Schicksalsschläge die Schönheit des Lebens und die Freude. Und er bittet um Gnade und Vergebung. Dass sich beinahe jeder Song zum Ende hin zur Ekstase bewegt, mag manchen alten Fan stören, doch das passt einfach perfekt zu jenem Prediger, der Cave im Herzen schon immer war.

Nick Cave and the Bad Seeds „Wild God“ (PIAS)
Leyya sind viel, aber sicher keine Prediger. Sophie Lindinger und Marco Kleebauer haben ihr Projekt lange ruhen lassen, da beide mit anderen Bands und Projekten – wie etwa My Ugly Clemetine oder Sharktank – durchaus ausgelastet sind. In knapp einer Woche nahmen sie „Half Asleep“ auf: Die Songs reflektieren innere Unruhe, Unsicherheit und die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt. Die beiden Soundbastler arbeiten mit verwaschenen Beats, verzerrten Stimmen und klassischen Instrumenten; damit setzen sie die Stimmung in der Zwischenwelt eindrucksvoll um. Dass dabei versteckt, aber unüberhörbar großartige Popsongs wie „I’m Around I’m Around“ oder „Nobody Cares, Lovely“ entstanden sind, darf bei der Könnerschaft der beiden nicht überraschen, sondern mittlerweile erwartet werden.

Leyya „Half Asleep“ (Ink Music)


