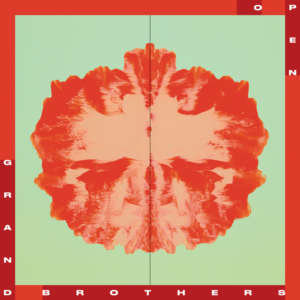Wenn die Sparks ein neues Album veröffentlichen, dann jubilieren die Fans – und der Rest der Welt hat wieder einmal keine Ahnung, was ihm entgeht. Seit 1972 produzieren die Brüder Mael Songs, die die Welt braucht, und das hat sich auf auf „Hippopotamus“ (BMG) nicht geändert. Nur die Erfinder des Synthie-Pop schreiben über die Dinge, die zählen und die tausenden anderen Songschreibern nicht einfallen wollen, wie z.B „Missionary Position“: ein herzzerreißendes Plädoyer für die Missionarsstellung und ihre Vorteile, das mit Zeilen wie „The tried and true ist good enough for me and you“ nicht geizt. Und wo andere seit Jahrzehnten ihrem Baby nachweinen, schreiben die Sparks eine Ode ans „Scandinavian Design“. Es gibt von diesen Stilisten kein schlechtes Album, dazu sind sie einfach zu gescheit und lieben ihre Kunst zu sehr, aber „Hippopotamus“ ist eines der großen Alben dieser Band geworden und wer die Möglichkeit hat diese Magier irgendwo live zu erleben, dem kann getrost gesagt werden: Diese Brüder sind noch in großer Form.
Der Brexit-Entscheid löste bei Robert Rotifer zuerst Unverständnis und dann Verzweiflung aus, schließlich sind er und seine Familie als langjährige Bewohner von London um Umgebung direkt von den Plänen der britischen Regierung, die ansässigen EU-Bürger über kurz oder lang aus dem Land zu drängen, direkt betroffen. Dazu kam, dass sein Freund Ernst Molden ihn schon länger dazu überreden wollte, deutsche Songs zu schreiben. Die schlaflosen Nächte nach dem Brexit waren wie geschaffen, Lieder in der ersten erlernten Sprache zu verfassen und das Ergebnis ist „Über Uns“ (Bader Molden Recordings): Mit seiner akustischen Gitarre erzählt Rotifer mit all seiner Höflichkeit und dem ihm eigenen Understatement von der Versuchung des Aufgebens und der Hoffnung, dass sich das Kämpfen am Ende doch lohnt. „Über Uns“ ist eine Momentaufnahme eines Mannes, der sein England immer geliebt hat, es aber nicht mehr erkennt – und damit das ruhigste und innigste Album in Rotifers Karriere.
Ruhig war es im letzten Jahr um Casper. Das lag vor allem daran, dass er sein Album „Lang lebe der Tod“ (Columbia/Sony) kurz vor dem Erscheinen zurückzog, weil es für ihn nicht fertig war. Casper investierte viel Zeit, um das Album so umzusetzen, dass auch er dazu stehen kann. Das Warten hat nun ein Ende. Und es hat sich ausgezahlt. Caspers Sprechgesang ist noch rauer geworden. Seine Texte sind rätselhafte Kunstwerke, die immer spannend bleiben und in beinahe jeder Strophe überraschen. Wie Casper hier Sprachkunst in die massenkompatible Popwelt einschleust, ist bewundernswert, denn schließlich ist er aufgebrochen, um ganz großen Pop zu machen und die Festivals als Headliner zu beglücken. Ohne sich zu verkaufen drückt er dem ganzen seinen Stempel auf. Das geht sich auf „Lang lebe der Tod“ aus – und nicht nur das: Auch ein Gastauftritt von Blixa Bargeld ist im Paket inbegriffen.
Auf die ganz großen Showeffekte haben The National immer verzichtet, denn eine Band, die Balladen pflegt, muss auf innere Spannung setzen. Auf „Sleep Well Beast“ beweisen sie wieder, dass sie ihre Kernkompetenzen beherrschen. Mit „The Day I Die“ ist ihnen sogar ein U2-Song ausgekommen, für den Bono auf seine Steuerkonstruktionen verzichten würde. Das Grundthema der Songs von „Sleep Well Beast“ sind die kleinen Brüche und Spannungen in langen Beziehungen. Die Songs von Matt Berninger und seiner Frau Carin Besser führen in die unzähligen Graubereiche, die Beziehungen zu bieten haben und trösten so all jene, die glauben, dass Künstlerbeziehungen anders funktionieren als die im eigenen Haus. Musikalisch sind The National eine Band, die angekommen ist.Sie wissen, wie man Songs orchestriert und wie sich die Stimme Berningers, den unbestrittenen Star der Band, still, aber effektiv unterstützen lässt. Überraschend an „Sleep Well Beast“ ist nur, dass The National auch auf dem siebenten Album nie langweilig werden. Das ist die wahre Kunst.
Die Stille war definitiv noch nie das Arbeitsgebiet der Queens of the Stone Age. Josh Homme und seine Bande stehen und standen für zähen, lauten und virtuosen Wüstenrock, der sich um Empfehlungen der Vereinigung der HNO-Ärzte noch nie gekümmert hat. So sind sie zu einer der bestimmenden Rockbands geworden. Konsequent wie Josh Homme nun einmal ist, lässt er den eher ruhigen Zugang, den er in seiner letzten Zusammenarbeit mit Iggy Pop gewählt hat, auf „Villains“ (Matador) wieder hinter sich und baut mit Hilfe von Starproduzent Mark Ronson in den Sound seiner Band ein paar Elemente Funk und einige Anleihen aus dem Fundus von Led Zeppelin ein, die das Headbangen aber in keiner Weise erschweren. Puristen mögen eine Abkehr von der reinen Lehre des Wüstenrocks erkennen, aber Ideologen haben immer etwas gegen Spaß. Und den gönnen sich Josh Homme und seine Weggefährten hier ausreichend.
Vom Wüstenrock hin zur Introspektion, von den lauten Gitarren zum leisen Klavier und von Songs hin zu Instrumentalstücken. Die Grandbrothers sind ein Duo, und sie nutzen auf „Open“ (City Slang) die Klangmöglichkeiten des Klaviers aus. Dazu haben sie noch ein paar Adaptionen am Flügel vorgenommen, um ihn auch als Rhythmusinstrument zu verwenden. Dazu kommt noch sanfte Elektronik. All das verbinden Erol Sarp und Lukas Vogel zu einer Klangwelt, die an die Minimal Music eines Philip Glass oder an Elektronikpioniere wie Rodelius oder Harmonia erinnert. Die Stücke schreien aber nicht nach dem Kammermusiksaal, obwohl sie auch dort bestens aufgehoben wären, sondern nach Popmusik und nach Gefühlen. Kühn formuliert könnte man behaupten, dass die Grandbrothers mit ihren Mitteln den Groove suchen und auf ganz verwundenen Wegen auch finden. Eines ist jedenfalls sicher: Der große Soundtrackauftrag kann nicht mehr lange auf sich warten lassen, denn spannendere Instrumentalstücke werden derzeit nirgendwo komponiert.